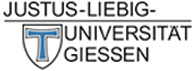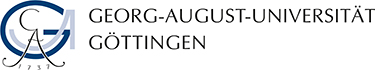Gesamtansicht Rezensionen
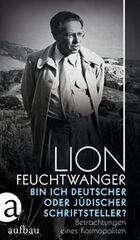
Er war – neben Thomas Mann und Stefan Zweig – einer der bekanntesten und meistgelesenen Autoren, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Doch auch im Exil blieb ihm der Ruhm treu. Er gehörte zu den ersten 33 Autor/INNEN, die ausgebürgert wurden; seine Bücher wurden öffentlich als „undeutsches Schriftgut“ verbrannt, seine liebevoll zusammengestellte Bibliothek zerstört, ebenso seine Manuskripte, an denen er noch gearbeitet hatte („Ich habe ein ganzes Jahr Arbeit verloren“), seine Schildkröten, da „jüdisch“, getötet, sein Haus konfisziert. Während seiner Amerika-Tournee 1932/33 erfuhr er, dass Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt worden war. Lion Feuchtwanger kehrte nie wieder nach Deutschland zurück. …
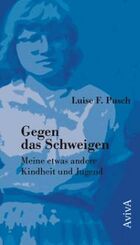
Von den ersten Nachkriegsjahren durch die Wirtschaftswunderzeit in die „Swinging Sixties“: Geschichten von Frauen, die in dieser Zeit entdeckten, lesbisch zu sein, waren kaum erzählbar; es gab keine Sprache dafür. Was nicht sein durfte, existierte einfach nicht. Das machte es schwer zu erkennen, was mit einer eigentlich los war; und warum die Panikattacken, die Depressionen, die Schweißausbrüche. In den reaktionären 1950er und 1960er Jahren bis weit über die sog. Sexuelle Revolution hinaus waren homosexuelle Kontakte bedrohlich. Nur Alleinsein bot eine gewisse Erholung vom Zwang zur Verstellung, zur sozialen Mimikry; eine Lösung des Problems war das nicht.
Homosexuelle Männer wie Didier Eribon, Paul Monette oder Daniel Schreiber veröffentlichen Berichte über die Kämpfe und Nöte ihrer Kindheit und Jugend – lesbische Frauen schwiegen. …
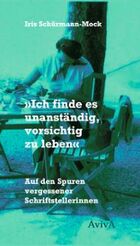
Der AvivA Verlag ist für Neues, Überraschendes, Innovatives und nur scheinbar „Abseitiges“ bekannt. Der Verlag mit seinem frühlingshaften Namen (Aviva ist die weibliche Schreibung von Aviv: hebr. Frühling) wurde 1997 von der Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin Britta Jürgs gegründet. Schwerpunkte des Verlagsprogramms sind Romane der 1020er Jahre, Werke von Frauen in der Kunst sowie Kulturgeschichte mit Schwerpunkt jüdische Geschichte.
In der Reihe „Wiederentdeckte Schriftstellerinnen“ veröffentlicht der Verlag in Erst- und Neuauflagen Werke aus den 1920er und 1930er Jahren von deutschsprachigen, vor allem jüdischen Autorinnen wie Victoria Wolf, Lili Grün, Alice Berend, Ruth Landshoff-York, Alice Rühle-Gerstel, Maria Leitner, Christa Winsloe, Lessie Sachs oder Vicky Baum. Die Autobiographie „Ein Mensch wird“ von der Schriftstellerin Alma M. Karlin (1889-1950), die ab 1919 acht Jahre lang die Welt bereiste, erschien erstmals im deutschsprachigen Original im AvivA Verlag, der auch die Reiseberichte der Autorin wieder veröffentlichte. …

Schon länger „trendete“ (S. 214) das Forschungsthema sexualisierter Kriegsgewalt; auf Ungarn bezogen kommt es spät. Tatsächlich bildet der ungarische Kontext das Zentrum, auch wenn die Autorin vornehmlich Gewalt gegen Frauen in ihren globalen Dimensionen gebührend erweitert. Petö packt das Leid vergewaltigter Frauen an der Wurzel, danach trachtend, ihnen eine Last abzunehmen. Diese glauben nämlich, das erlittene Schicksal „immer als persönliches Erlebnis“ tragen zu müssen, weil sie es „nie in eine[n] größeren Rahmen“ (S. 134) stellen können. Dazu holt die Autorin weit aus. …
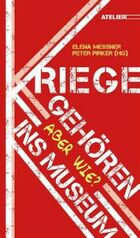
Ruhm und Anrüchigkeit vertragen sich nicht! Das ‚Heeresgeschichtliche Museum‘(HGM) in Wien ist in Verruf geraten, nicht zuletzt auch behördlich. Wegen seiner antiquierten Ausrichtung, seines Leitungspersonals in Geschäftsgebarung und politischer Akzente (heute wie traditionell). Seit 1856 bildet das zwar multifunktionale Gebäude, als Arsenal stets militärisch gedacht, eine „belligerante Eigenwelt“; bald genutzt aber als eines der Säulen „musealer Darstellungen der Habsburgermonarchie in Österreich“ (S. 72). Die Herausgeberschaft des Sammelbandes betont eigens die „weit über die Problematik des HGM hinausgehende“ (S. 14) Brisanz der Debatte. Die Kapitelabfolge lässt als Schwerpunkte solche zur Historisierung des Museums, zu diesbezüglich diversen Positionen sowie zu Vorschlägen für Neuausrichtungen erkennen. Die für die Monarchie zuständige Historikerzunft nimmt sich im Vergleich unaufgeregt aus. Nüchtern wird konstatiert, dass „es sich um die Hinterlassenschaft der kaiserlichen Armee und ihrer Nachfolgeorganisationen“ (S. 319) handelt. Abzutun sei dies aber nicht so, wie im Museum dargestellt. …
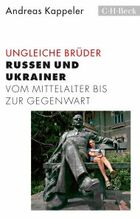
Familial fasst der Autor das Verhältnis der in den jeweiligen, sich auch überschneidenden Geosphären lebenden Menschen dieses Namens. ‚Streit in der Familie‘ kommt vor! In den Kapitelüberschriften ist jedoch viel von ‚Eintracht‘, vom Gemeinsamen die Rede: in der ‚Wiege der Kiewer Rus‘; als ‚verspätete Nationen‘; den zweierlei Ausformungen einer geteilten ‚Russischen Revolution‘ sowie im Gefolge zusammen in der ‚Völkerfamilie‘ der Sowjetunion. Selbst ‚Annäherungen der Ukraine an Russland‘, die Integration ins Zarenreich ist nicht einseitig vorstellbar; wäre da nicht das Urteil eines ‚asymmetrischen‘ Verhältnisses, der imperialen Beherrschtheit der Ukrainer, unter russischer „Hegemonie“ (S. 129). …

In der Art eines Tributs an den ‚cultural turn‘, genauer dem ‚emotional turn‘ nimmt sich das Forschungsteam den Radien von Aktivierungen der im Untertitel genannten fünf Sinne anlässlich von Alpenerlebnissen an. „Die Alpen sind ein ubiquitäres Gebirge“ (S. 105), heißt es; dem entsprechend verklammert der schmale Band einen Reichtum an Aspekten. Die gelieferten Erkenntnisse des Teams (aus den Bereichen Historik, Ethnologie, Dialektologie, Musik- und Literaturwissenschaften, Populäre Kulturen) markieren in ihren Skizzen anhand von Evokationen bestimmter Sinnesareale die sich geschichtlich durchziehende Allianz von ‚Genuss und Geschäft‘. Die Kapazitäten des Alpennutzens, wovon hauptsächlich die Rede, bieten Räume der Arbeit und der Erholung. …

Mit zentraler Peilung auf die beiden Werften in Gdynia (Polen) und Pula (Kroatien) birgt die aus einem Forschungsprojekt (2016-2021) hervorgegangene, wahrhaft dichte Faktenpräsentation des erklärten ‚Werftenkollektivs‘ Erkenntnisse, die es, dem Team nach, aufgrund der Lage von Archivbeständen, Quellenverfügbarkeit aus Interviews, aktueller politischer Rahmenbedingungen gerade eben noch zu bergen galt: dergestalt ein „Zeitdokument“ (S. 71). Das Globale so detailreich „im Lokalen zu suchen“ (S. 62), veranlasst „empirische Tiefenbohrungen“ (S. 63). Hervorgehen sollen daraus „die Veränderungen in den Sinnwelten sozialer Gruppen“ (S. 23), jene „‚Transformations from Below‘“ im Zuge weltumspannender Transformationen (S. 23). …

Mit dem 58. Materialheft zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens werden die Forschungsergebnisse der mehrjährigen Grabungen in der Lichtensteinhöhle bei Osterode am Harz vorgestellt. Die umfangreichen Funde, vor allem darunter mehr als 4.000 Menschenknochen, die zahlreichen technischen Untersuchungen und das erläuternde Kartenmaterial haben eine dreibändige Zusammenstellung nötig gemacht. Auf mehr als 700 Seiten stellt Stefan Flindt die Lage der Fundstelle und das archäologische Umfeld dar (S. 17-22), geht auf die Entdeckungsgeschichte ein und stellt die verschiedenen Befunde, die zusammen mit Jens Lehmann ergraben wurden (S. 46-344, 344-518), und deren Auswertung vor (S. 616-665). Als mehr oder weniger eigenständiger Teil schließt dies den unter Mitarbeit von Susanne Hummel und Marthe Frischalowski entstandenen Exkurs zu den Menschenknochen ein (S. 518-616). Der zweite Teilband versammelt auf weiteren 200 Seiten Listen, den Fundkatalog mit Beschreibungen aller Objekte und zahlreichen Umzeichnungen sowie Tafeln. In einem Schuber, als dritter Teilband konzipiert, sind großformatige Karten beigegeben. …
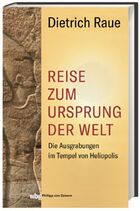
Dass es im Vergleich zu altägyptischen Kultplätzen wie Karnak, Edfu, Dendera oder Abydos zu Heliopolis nur wenige allgemeine Darstellungen gibt, liegt vor allem an dem schlechten Erhaltungszustand der Tempelanlage, die bereits seit der Antike zur Steingewinnung (S. 331) abgetragen wurde.
Von dem wohl größten Tempelbau Ägyptens hat sich im heutigen Stadtbild am Rande Kairos denkbar wenig erhalten; …