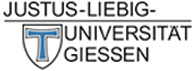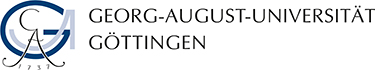Gesamtansicht Rezensionen

Exzeptionelle, nämlich familiäre Gründe der Autorin bestimmen das Schreibmotiv, Stoffspezifik sowie die Wahl des Schauplatzes: sieben Generationen ihrer Verwandtschaft haben 158 Jahre in Brestowatz (Szilberek, Brestowac, Ulmenau; nunmehr Backi Brestowac) verbracht. Die Lebensvollzüge anderer Dorfwelten der Batschka (Karte, S. 20) werden einander geähnelt haben. Beim Verfolg der manifesten (nachweisbaren) und latenten (imaginierten) Spuren ihres persönlich fokussierten ‚Mikrokosmos Brestowatz‘ thematisiert sie die zahlreichen, für ein Insgesamt der Region (und über diese hinaus) ins Gewicht fallenden Effekte dieser Dorfkollektive gleich mit; sie konturiert dabei eine mittlerweile sich verflüchtigt habende, ‚atlantisch‘ gewordene Sozialarchitektur. …
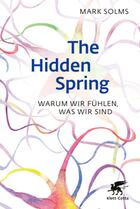
Warum sollten sich Literaturwissenschaftler:innen mit neurowissenschaftlichen und neuropsychologischen Forschungen beschäftigen? Eine zentrale Antwort auf diese Frage ist, dass diese Disziplinen einige fundamentale Gemeinsamkeiten haben, etwa die Beschäftigung mit einem der grundlegenden Bedürfnisse und Merkmalen menschlichen Verhaltens: dem Erzählen, das Gedächtnisinhalte und Bewusstsein voraussetzt. Aber auch die damit verbundene existenzielle Überlegung nach dem, was menschliches Bewusstsein überhaupt ist, beschäftigt die Literatur und Literaturwissenschaftler:innen bereits viel länger, als es Neurowissenschaften überhaupt gibt. …

Für ein „Erbarmen mit den Deutschen“, so ein älterer Buchtitel, hat sich Henryk M. Broder schon vor Jahrzehnten ausgesprochen. Nach den wechselvollen Schröder-Jahren, Angela Merkels bleierner Regierungszeit und rechtzeitig zur Ampel-Halbzeitpause lädt er nunmehr gemeinsam mit Reinhard Mohr, früherer Pflasterstrand-Schreiber, zum Streifzug Durchs irre Germanistan ein. Aktuelles aus deutschem Innenleben wird hier thematisch gebündelt in 59 bissigen Glossen abgehandelt. Was dem Deutschlandkritiker Rolf Winter in den letzten Amtsjahren von Helmut Kohl noch vornehm als „Die politische Kultur der Bundesrepublik“ begegnete, ist knapp drei Jahrzehnte später zum grotesken nationalen Politschauspiel mit Krankheitswert verkommen. …

Biographien über Opfer und Überlebende des Holocaust zu schreiben, bedeutet, das Leben „von ganz gewöhnlichen Menschen in außergewöhnlich dunklen Zeiten“ zu schildern, wie es Miep Gies (1909-2010), Gerechte unter den Völkern und Helferin Anne Franks in ihren Erinnerungen tat.
Vorliegender Beck-Wissen-Band über die Jüdin Anne Frank (1929-1945) wurde von Ronald Leopold, Historiker und Generaldirektor des Amsterdamer Anne Frank Hauses verfasst. Er
beinhaltet als Hauptteil einen biographischen Abriss (S. 9-82), berichtet aber auch über die Kriegsheimkehr des Vaters Otto (1889-1980) und behandelt das Tagebuch Anne Franks und das 1960 eröffnete nach ihr benannte Haus sowie die vielfältigen Facetten eines nach 1945 einsetzenden weltweiten kollektiven Gedächtnisses an das jüdische Mädchen (S. 83-136). …

Der unter ‚Nachwort‘ und ‚Angaben‘ rubrizierte Teil umfasst ein Drittel des Bändchens - mit gutem Grund. Befinden sich hier doch Angaben zur Textgenese, zu Grundzügen bisheriger Rezeption sowie den Erwartungen, die mit der Neuherausgabe verknüpft werden. Allem voran interessieren die politischen Implikationen des, so der Herausgeber, eine „Schlüsselstellung“ (S. 83) einnehmenden Textes; gefragt wird, ob die „Einschätzung erlaubt [sei]“, dass sprachkritische Argumente gegen nationalistische Positionen eingesetzt werden können“ (S. 95). …
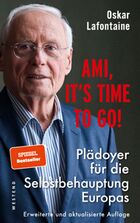
Oskar Lafontaine, zeitlebens eng mit der Entspannungspolitik Willy Brandts verbunden und prägende Gestalt der deutschen Sozialdemokratie der 1990er Jahre, bezieht nach Rückzug aus politischen Ämtern weiterhin Stellung zu Brandherden und politischen Konfliktfällen. Inhalte seines neusten Buches Ami, it's time to go! wirken hierbei wie die Orchesterfassung der
zahlreichen medialen Äußerungen seiner Ehefrau Sahra Wagenknecht. Lafontaines Aufruf zum Abzug US-amerikanischer Präsenz aus Europa ist dreigliedrig und startet mit dem Szenario des von Russland begonnenen Krieges gegen die Ukraine. …
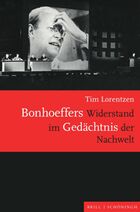
Tim Lorentzen hat mit dem Band „Bonhoeffers Widerstand im Gedächtnis der Nachwelt“ eine Ereignisgeschichte des Gedenkens an Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) in den Jahren 1945 bis 2006 vorgelegt. Dass es sich hier um eine Ereignisgeschichte handelt, ist an dieser Stelle eigens zu betonen, da Lorentzen nicht daran interessiert ist, die Rezeption von Bonhoeffers Wirken zu untersuchen, sondern die Funktion der Gedenkakte an seinen Widerstand in der jeweiligen Gegenwart zu eruieren. Dazu bezieht er sich auf rituell oder kulturell gerahmtes Gedenken an Gedenkorten oder anlässlich verschiedener Gedenktage, wie Bonhoeffers Geburts- und Todestag oder den 20. Juli, um diese Reziprozität nachzuzeichnen sowie Rückschlüsse auf die so betriebene Geschichtspolitik (in engem Anschluss an Edgar Wolfrum [*1960]) zu ziehen. …
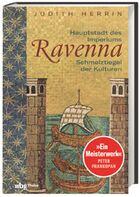
Die Byzantinistin verleiht Ravenna „eine eigene Stimme“, die der Stadt versagt blieb, da sie „ihre führende Rolle stets durch Außenstehende aufgezwungen bekam“ (S. 461). Zudem nötigen die „Lücken“ durch Tilgungen, Verwitterung, Demontagen dazu, viel „Fantasie“ aufzuwenden, gerade diese Stadt „immer wieder neu [zu] überdenken“ (S. 458). Das Bedauern ob dieses charakteristischen Mangels drückt die Autorin gemäß ihrem Metier, wo Reliquie und Relikt oft eins sind (angesichts der in Ravenna von Touristen zurecht so bestaunten und breitenwirksam bekannten Mosaiken), so aus: „Von Theoderichs Porträt ist nicht einmal ein Fingernagel erhalten“ (S. 459). …
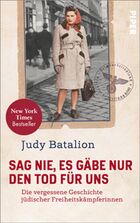
Dieses Buch verdankt sich einem Zufall. Die Kunsthistorikerin und Autorin Judy Batalion recherchierte 2007 über jüdische Frauen im 20. Jahrhundert. Dabei fiel ihr ein jiddischer Band über Frauen im Ghetto in die Hände, der unweigerlich auch vom Widerstand jüdischer Frauen zeugte. In den folgenden Jahren bis zur Erstveröffentlichung 2020 in den Vereinigten Staaten trug Batalion zahllose Mosaiksteine zusammen, aus denen sie schließlich das nun auch auf Deutsch vorliegende umfassende Panorama über den Widerstandskampf jüdischer Frauen vor allem im deutsch besetzten Polen zusammensetzte. Was für Batalion am Ausgangspunkt die Entdeckung eines ihr unbekannten Themas war und der deutsche Verlag als eine „vergessene Geschichte“ betitelt, war in Teilen freilich auch schon zuvor bekannt und bereits erforscht. …
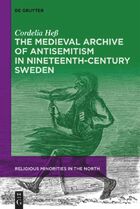
In dieser Studie untersucht Cordelia Heß mittelalterliche anti-jüdische Denkfiguren wie den Ahasverus-Mythos, den Judas-Mythos und die Substitutionstheologie, und ihr langes Nachleben im Schweden des 19. Jahrhunderts. Anti-jüdische Bilder waren dabei in Schweden schon bekannt und breit tradiert, als es im Land noch keine etablierte jüdische Minderheit gab. Heß stellt fest, dass im Laufe des Untersuchungszeitraumes zwar neue antisemitische Konzepte hinzukamen, zuvor schon vorhandene vorreformatorische altkirchliche Motive jedoch nicht aus dem Diskurs ausgeschieden wurden, sondern wiederholt reaktiviert wurden. …